
Hooksiel (2. 2. 2025) – Heute vor 200 Jahren: In Crildumersiel unweit von Hooksiel überlegt Bauer Oltmanns, ob er angesichts einer nahenden Flut das Vieh im Stall losbinden soll. Da brich auch schon das Scheunentor, Wasser strömte herein. Oltmanns und seine Familie haben alle Mühe, sich auf den Dachboden zu retten. Dort bemerkt der Bauer, dass ein kleiner Sohn und ein Knecht fehlen. Er will heruntersteigen, um beide zu retten, aber das Wasser ist schon zu hoch angestiegen.
Am nächsten Tag klettert der Bauer vom Boden herab und hört Stimmen. Der Junge und der Knecht haben überlebt. Sie waren in der Stube auf einen hohen Schrank geklettert. Das Wasser war bis an dessen Oberkante gestiegen, aber nicht höher.
Viele Deiche gebrochen
Oltmanns verlor wie viele andere fast sein gesamtes Vieh. Sein Haus selbst überstand die Flut aber recht gut. Andere traf es deutlich härter. Die Februar-Flut 1825 überspülte an der gesamten Nordseeküsten Deich, viele Schutzdämme brachen und zahllose Menschen starben. Tausende verloren ihr komplettes Hab und Gut. Auch in Hooksiel.
Hooksiel war damals florierender Handelshafen. An den Packhäusern am Hafen wurden für den Export vorgesehene Waren und Importgüter zwischengelagert. Ein Großteil davon wurde durch das Sieltor über das Hookstief zur Metropole Jever transportiert.
Am 3. Februar 1825, einem Donnerstag, und die Tage danach, ging es nicht um Geschäfte. Viele Menschen hinter den Deichen von Hooksiel bis Schillig und weiter bis Carolinensiel mussten um ihr schlichtes Leben kämpfen. Der nördliche Flügeldeich in Hooksiel brach mehrfach, Menschen ertranken, Häuser wurden zerstört. Das Sieltor selbst aber konnte gehalten werden.
24 Menschen ertrunken oder erfroren
Die Schutzwälle am Neu-Wiarder-, Neu-St. Jooster- und am Neu-Pakenser-Groden wurden überspült. Das gesamte Binnenland stand unter Wasser. Allein im Bereich des Amtes Minsen, zu dem Hooksiel damals gehöre, sollen 24 Menschen ertrunken oder erfroren und 143 Stück Vieh umgekommen sein. Die Schäden der Februar-Flut waren dramatisch waren, aber nicht mit denen der Weihnachtsflut 1717 vergleichbar. Dabei kamen im Jeverland 1649 Menschen ums Leben.

Bereits in der Nacht zum 3. Februar hatte es kräftig gestürmt. Das Mittaghochwasser lief in der Folge deutlich höher auf als üblich. Anhaltender Sturm, von West auf Nord drehend, verhinderte, dass das Wasser bei Ebbe wieder ablaufen konnte. Mit dem Einsetzen der nächsten Flut stieg der Wasserstand weiter an, erreiche die Deichkronen und schwappte über. Der Höchstwasserstand soll laut späteren Rekonstruktionen bei 4,30 Meter (Wangerooge) und 5,00 Meter (in der Jade) über dem normalen Hochwasserstand gelegen haben.
Am Hotel Packhaus am Alten Hafen findet man die Flutmarken (Foto) von späteren Sturmfluten. Im Februar 1962 erreiche das Wasser eine Höhe von über 6 Meter.
Berichte von Zeitzeugen
Seit dem Herbst 1824 hatten bereits eine ganze Reihe von Stürmen die ohnehin schlecht unterhaltenen Deiche vorgeschädigt, so dass der Schutzwall vielfach der Naturgewalt nicht stand hielt. Einen guten Eindruck von der Katastrophe vermitteln die Aufzeichnungen von Friedrich Arends (Bremen), der noch 1825 aus Darstellungen von Augenzeugen und Behörden ein „Gemählde der Sturmfluten vom 3.-5. Februar 1825“ für die gesamte Nordseeküste gezeichnet hat. Seine Darstellung ist in voller Länge einsehbar (Link zum Google-Buch auf Wikipedia bei den Anmerkungen zum Stichwort Sturmflut 1825).
Im Bereich von Minsen war demnach der Deich schon gegen 22 Uhr gebrochen. Das Wasser strömte in mächtigem Schwall übers Land und lief in die Häuser. Die Menschen versuchten ihr Vieh zu retten, klettern auf Böden und Dächer oder versuchten in der Kälte durch das Wasser, die höher gelegene Deiche zu erreichen. Wer dabei vom Weg abkam oder in einen Graben trat, war meist verloren.
Stauer versinkt in den Fluten
Vor Neu-Augustengroden lief ein Schiff auf Grund, das sich in Carolinensiel losgerissen hatte. Die Besatzung konnte sich retten. Das Schiff selbst trieb weiter und wurde letztlich nahe Schillig über den Deich auf ein Haus geschwemmt.
In Hooksiel wurden die hinter dem nördlichen Flügeldeich stehender kleiner Häuser überspült. Ein Teil der Hooksieler wurde von der Flut überrascht. Auch ein Armenhaus wurde halb zerstört. Die Bewohner seien erst aufgewacht, als das Wasser schon im Haus stand, berichtet Arends. Ein Teil der Bürger wurde mit ihren Häusern weggespült. Andere, darunter auch kleine Kinder, ertranken.
Der Stauer Wehner sei vor seine Tür gegangen und wurde dort von den Flut erfasst. Geistesgegenwärtig packte er den Ast einer Weide, an der er sich festhalten und um Hilfe rufen konnte. Vergebens. Seine Frau rief ihm zu, er solle sich auf die Trümmer eines vorbei treibenden Daches herablassen, um so zum sicheren Mitteldeich zu gelangen. Der Stauer befolgte den Rat. Das Dach schlug um und er versank in den Fluten.
Große Tatkraft und viel Mut
Ein Phänomen, an das man in einer Gedenkfeier erinnern sollte: In jeder Katastrophe gibt es die Helden, die durch Tatkraft, Mut und Menschlichkeit glänzen. In Hooksiel gehörte Amtmann Hollmann dazu, der es schaffte, die Hooksieler Bürger dazu zu motivieren, ihre ganze Kraft dafür einzusetzen, mit Hilfe von Steinen, Holz und Stroh zu verhindern, dass das hölzerne Sielwerk, das Schutzbollwerk für das Hinterland, seitlich umspült wurde. Als Belohnung erhielt der Amtmann dafür laut den Recherchen von Hans Ney („450 Jahre Hooksiel“) im Nachgang vom Großherzog 1000 Reichstaler.

Arends berichten unter anderem von Schlächter Eiben, der durch sein „tätiges Mitleid“ viel Gutes getan habe. Er habe viele Menschen aufgenommen, die obdachlos der Kälte ausgesetzt waren, und habe überall versucht, Menschen zu retten, wo es ihm möglich war. Lobend erwähnt werden auch die Schiffer Jacobs und Wilts sowie der Schneider Hillers, die mit einem Boot im Hooksieler Umland etlichen Menschen das Leben gerettet haben sollen.
Hilfe per Floß aus Jever
Nach der eigentlichen Flut strömten viele Menschen, die alles verloren hatten, aus der Umgebung nach Hooksiel. Ihre Versorgung war extrem schwierig. Trinkwasser und Vorräte waren verdorben, die Lage aussichtslos. Erst nach vier, andere Quellen sagen nach acht Tagen nahte Hilfe. Aus Jever kam ein Floß durch das überschwemmte Gebiet und brachte Brot und Wasser für die Geschundenen.
An viele Schicksalstage und Katastrophen wird in Gedenkstunden erinnert. Mit Blick auf die zeitlos große aktuelle Bedeutung der Deichsicherheit gäbe es in diesen Tagen gute Gründe dafür, den 3. und 4. Februar 1825 ins Gedächtnis zu rufen. Und auch auch tätige Hilfe in der Not ist heute mindestens so wichtig wie damals.



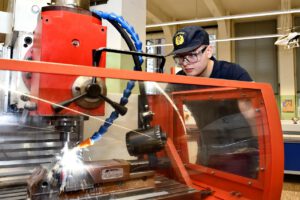


Kommentare sind deaktiviert.