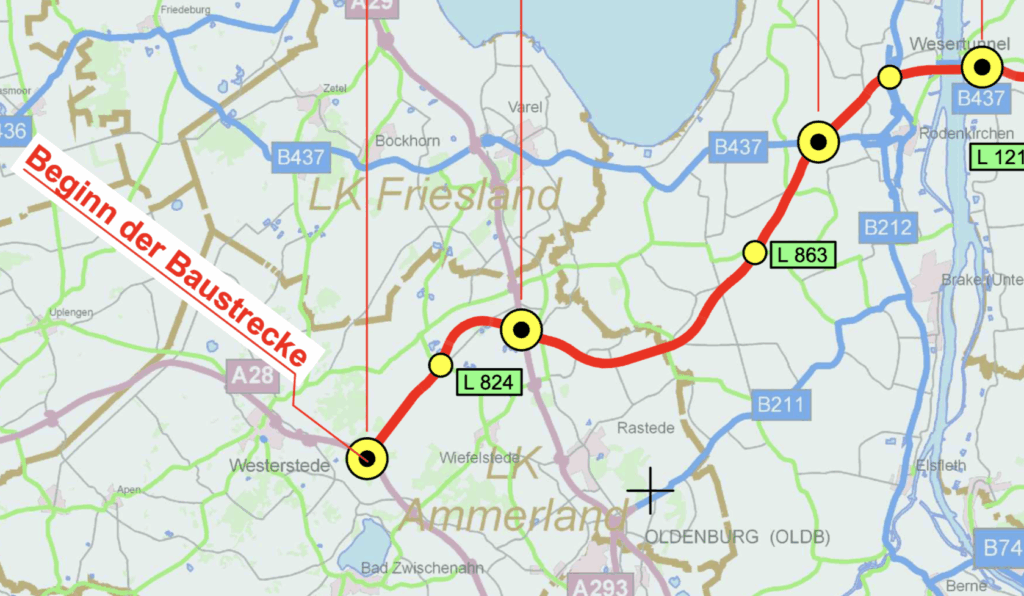Wilhelmshaven/Wangerland (17.12. 2025) – Ein Pfosten, daran drei dunkle Kästchen. Was auf den ersten Blick nach obskurer Kunst wirken könnte, ist tatsächlich moderne Forschung. Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist seit September Teil des Projekts „KI-Nationalpark“, einem bundesweiten Modellvorhaben.

In deutschen Nationalparken und Wildnisgebieten wird erstmals ein schutzgebietsübergreifendes, KI-gestütztes Monitoringsystem aufgebaut, das Biodiversität, Klimafaktoren und menschliche Nutzung gemeinsam erfasst und auswertet. Ziel ist es, den Schutz der biologischen Vielfalt zu verbessern und die Grundlagen für ein zukunftsfähiges Management zu schaffen.
Datenerfassung ohne Störungen
„Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz stellen wir Technik in den Dienst der Natur. Die automatisierte Datenerfassung und -auswertung ermöglicht uns, Veränderungen im Gebiet des Nationalparks schnell und präzise zu erkennen, ohne dadurch Störungen für die Tierwelt zu verursachen“, erklärt Benedikt Wiggering, Projektkoordinator bei der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven.
Das Projekt wird von Nationale Naturlandschaften e. V. koordiniert und gemeinsam mit der Universität Freiburg und der biometrio.earth GmbH umgesetzt. Gefördert wird es durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK), Förderlinie „KI-Leuchttürme“.
Neues Werkzeug für den Naturschutz
Mit einem bundesweiten Netzwerk von Fotofallen, Audiologgern (den Kästen am Pfosten) und Klimaloggern werden Daten zu Artenvielfalt, Tierpopulationen, Umweltfaktoren und menschlichen Einflüssen gesammelt. Die Geräte zeichnen unter anderem Vogelstimmen, Fledermäuse, größere Säugetiere oder Geräuschquellen wie Landwirtschaftsmaschinen und Freizeitaktivitäten auf. Künstliche Intelligenz ermöglicht die automatische Auswertung der großen Datenmengen: Arten werden identifiziert, menschliche Störungen erfasst und Zusammenhänge zwischen Klima, Biodiversität und Nutzung sichtbar gemacht.
Projekt läuft bis 2027
„Mit KI-Nationalpark schaffen wir ein Werkzeug, das den Schutzgebietsverwaltungen erstmals schnelle, belastbare und vergleichbare Daten an die Hand gibt“, sagt Marla Schulz, Projektkoordinatorin beim NNL e.V. „So können wir Biodiversität und Klimaschutz noch besser zusammen denken – und unsere Nationalparke als Schatzkammern der Natur langfristig sichern.“
Das Projekt soll von 2025 bis 2027 in 13 Nationalparken und zwei Wildnisgebieten in ganz Deutschland laufen. Die gesammelten Daten fließen in einen anpassungsfähigen Management-Zyklus ein, in dem mithilfe der KI Veränderungen und Störungen schneller erkannt werden können, so dass Maßnahmen zeitnah angepasst werden. Am Ende des Projekts sollen daraus konkrete Handlungsempfehlungen für das Schutzgebietsmanagement abgeleitet werden.