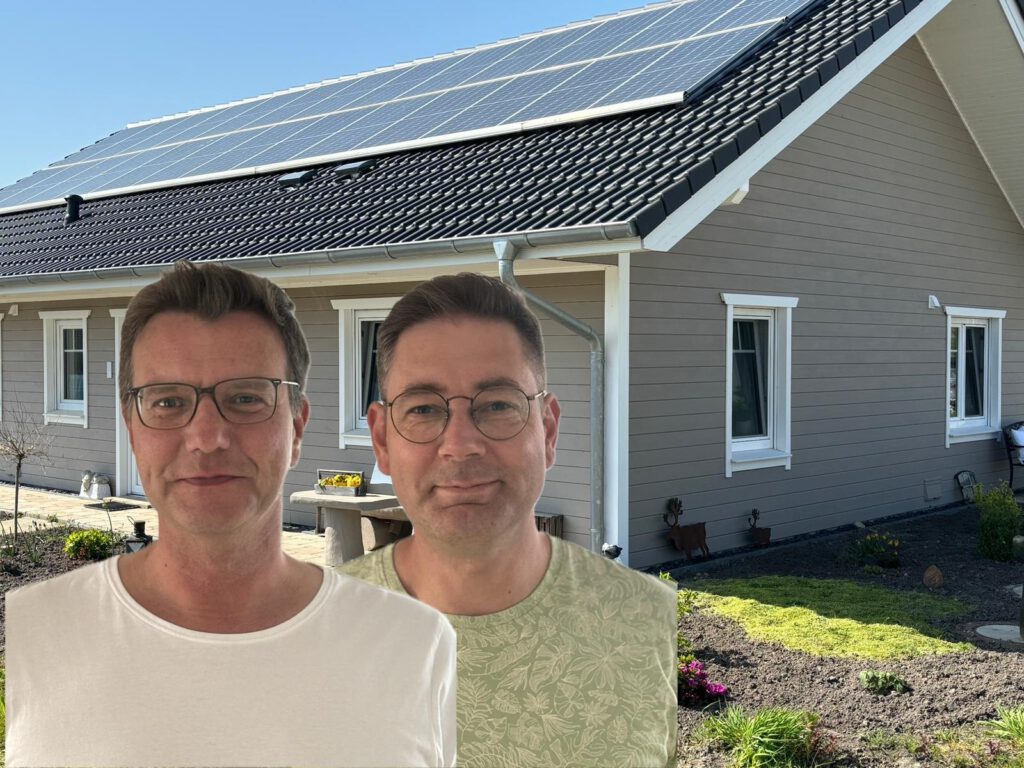Wangerland/Wilhelmshaven (7. 11. 2025) – Der Deutsche Bundestag hat gestern mit der Verabschiedung des Kohlendioxid-Speicherungs- und -Transportgesetzes die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, in industriellen Prozessen unvermeidbar anfallendes Kohlendioxid (CO2) abzuscheiden, zu transportieren, zu nutzen oder sicher zu speichern. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anne Janssen (Wittmund) sieht darin den richtigen Weg, Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Umweltschutzverbände befürchten eine zunehmende Industrialisierung der Nordsee.
Lösung für unvermeidbares CO2
Mit dem neuen Gesetz, so Janssen, Vorsitzende des Arbeitskreis Küste der CDU/CSU-Fraktion, werde der Weg frei für industrielles, technologieoffenes CCS in Deutschland. CCS steht für Carbon Capture and Storage, also fürs Abspalten und Speichern von klimaschädlichem CO2. Insbesondere für die energieintensive Zement-, Stahl- und chemische Industrie, aber auch für Gaskraftwerke, gilt CCS als Chance, klimaverträglicher zu produzieren.


Bislang war die unterirdische Speicherung von CO2 auf deutschem Boden weitgehend verboten. Mit dem neuen Gesetz, so Janßen, bekämen Unternehmen Planungssicherheit, um in emissionsarme Produktion zu investieren, statt abzuwandern. „Für unsere Region als bestehende Energiedrehscheibe ist das eine echte Zukunftschance“, sagte Janssen mit Blick auf Wilhelmshaven. „Mit CO₂-Infrastruktur, Offshore-Speicherung und der Verzahnung mit Wasserstoff können Wertschöpfung, gute Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit im an der Küste wachsen.“
Chance für die Energiedrehscheibe
Im Kreis der zum „Energy Hub Port of Wilhelmshaven“ gehörenden Unternehmen gibt es Pläne, über Wilhelmshaven den CO2-Export zu Speicherstätten in der Nordsee zu ermöglichen. „CCS ist ein wichtiger Baustein der deutschen Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit und für Wilhelmshaven und die Jade-Region als Drehscheibe eine große Chance“, sagt Uwe Oppitz, Sprecher des Energie Hub.
Das in der industriellen Produktion anfallende CO2 könnte abgeschieden und etwa per Pipeline nach Wilhelmshaven gebracht werden, von wo aus es zu einem CO2-Speicher unter der Nordsee transportiert würde. Die vom Gesetzgeber verabschiedete Carbon-Management-Strategie soll eine Kohlenstoffkreislauf-Wirtschaft ermöglichen.
Scheinlösung mit hohem Risiko
Der Naturschutzbund (Nabu) sieht bei der CO₂-Speicherung im Meeresuntergrund noch offene Fragen zum Umweltrisiko. Der Verband fordert eine verbindliche Entlastung der Nordsee durch andere Maßnahmen vor der Freigabe von CCS im Meer für tatsächlich unvermeidbare Restemissionen.
Auch die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN) mit Sitz in Varel äußert „starke
Bedenken“ gegen beabsichtigte Verpressung von CO2 unter dem Nordseegrund. Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner, Vorsitzender der SDN: „Wir lehnt diese Scheinlösung zum Klimaschutz entschieden ab!“ Es fehle zum Beispiel eine Bilanzierung zum wirklichen Nutzen von CCS. Die CO2-Verpressung im Nordseeuntergrund sei zudem ein Verstoß gegen die Vorgaben der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der Europäischen Union. Der Weg, die Nordsee als Müllkippe zu nutzen, sei eine Gefahr für Mensch und Natur.